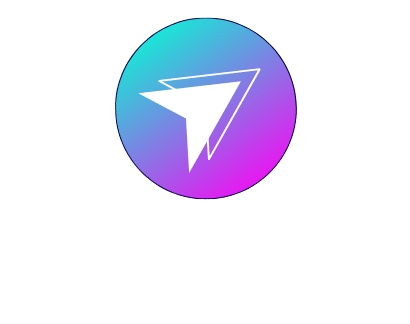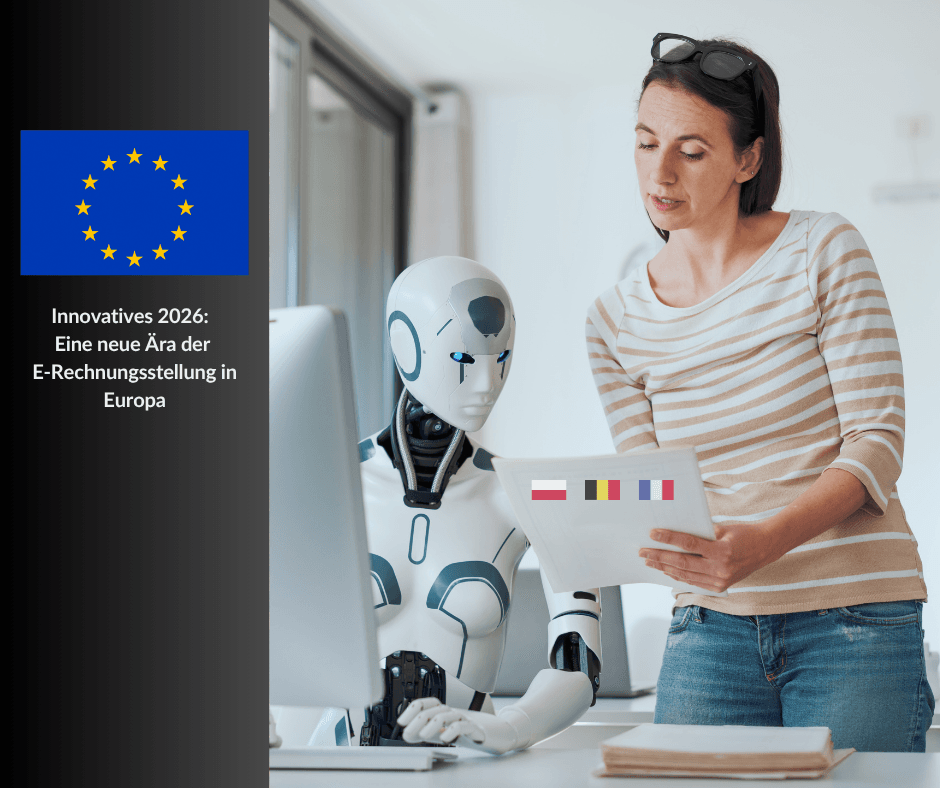2026: Eine neue Ära der E-Rechnungsstellung in Europa
Das Jahr 2026 kündigt sich als ein entscheidender Wendepunkt für die digitale Rechnungsstellung in Europa an. Obwohl es keinen einheitlichen Termin für die gesamte Europäische Union gibt, werden viele Mitgliedstaaten in diesem Zeitraum die Pflicht zur E-Rechnungsstellung im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen (B2B)einführen. Zu den Vorreitern gehören Polen, Belgien und Frankreich, die ihre Abrechnungssysteme auf unterschiedliche Weise modernisieren werden.
Verschiedene Ansätze für dasselbe Ziel
Jedes Land setzt diesen Prozess in seinem eigenen Tempo und gemäß den lokalen Anforderungen um:
Polen integriert die E-Rechnungsstellung in die Echtzeit-Steuerberichterstattung.
Belgien konzentriert sich zunächst auf den digitalen Rechnungsaustausch und verschiebt die Berichterstattungsphase.
Frankreich setzt auf zertifizierte private Plattformen für die Bearbeitung von E-Rechnungen und führt gleichzeitig ein neues Berichtssystem ein.
Andere Länder, wie Irland und Deutschland, bereiten sich auf die Umsetzung der Änderungen in späteren Jahren vor – nach 2027 bzw. 2028.
E-Rechnungsstellung ist längst nicht mehr nur eine administrative Anforderung – sie wird zum Grundpfeiler der Geschäftstätigkeit. Nach Inkrafttreten der neuen Vorschriften werden Papierdokumente und PDF-Dateien nicht mehr als gültige Rechnungen anerkannt. Ihre Verwendung kann zu Strafen führen, und Geschäftspartner können die Mehrwertsteuer (MwSt.) nicht mehr abziehen. Wie die Brüsseler Agentur für Unternehmertum erklärte:
„In Zukunft wird die elektronische Form die einzige zulässige Art der Rechnungsstellung sein.“
Polen: Das Nationale E-Rechnungssystem (KSeF)
Ab Februar 2026 wird die E-Rechnungsstellung in Polen verpflichtend. Das Nationale E-Rechnungssystem (KSeF)wird als zentrale Plattform fungieren, über die jede Rechnung laufen muss, bevor sie an den Kunden zugestellt wird. Das System weist jeder Rechnung eine eindeutige Referenznummer zu und übermittelt die Daten automatisch an das Finanzamt.
Die Einführung erfolgt in mehreren Phasen:
Februar 2026 – Verpflichtung für große Unternehmen (Umsatz über 200 Mio. PLN),
April 2026 – Ausweitung auf kleine und mittlere Unternehmen,
Januar 2027 – Ausweitung auf Kleinstunternehmen.
Bis Ende 2026 werden keine Strafen verhängt – dies ist eine Übergangszeit, die den Unternehmen helfen soll, ihre Systeme und Prozesse anzupassen.
Eine Neuerung ist der „Offline24“-Modus, der es ermöglicht, Rechnungen auch bei Internetausfällen auszustellen, sofern die Dokumente am nächsten Werktag an das KSeF-System übermittelt werden.
Belgien: Peppol und steuerliche Anreize
Ab 1. Januar 2026 sind alle belgischen Unternehmen verpflichtet, E-Rechnungen gemäß dem Peppol BIS 3.0-Standard auszustellen. In dieser Phase gilt die Pflicht ausschließlich für die Rechnungsstellung; die digitale Berichterstattung wird erst 2028 eingeführt.
Um den Übergang zu erleichtern, hat die belgische Regierung finanzielle Anreize geschaffen – darunter die Möglichkeit, 120 % der Kosten für die Einführung der E-Rechnungsstellung (einschließlich Software, Schulungen und Beratung) in den Jahren 2024–2027 steuerlich abzusetzen.
Frankreich: Private Plattformen und E-Berichterstattung
In Frankreich beginnt die verpflichtende E-Rechnungsstellung und E-Berichterstattung für inländische B2B-Transaktionen am 1. September 2026. Das System basiert auf zertifizierten privaten Plattformen (Plateformes Agréées – PA), die den ursprünglich geplanten öffentlichen PPF-Portal ersetzen.
Ab demselben Datum müssen alle in Frankreich mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen elektronische Rechnungen empfangen können, während größere Unternehmen sie auch ausstellen müssen. Kleinere Unternehmen werden ein Jahr später folgen.
Die E-Berichterstattung umfasst Transaktionen, die nicht über das E-Rechnungssystem abgewickelt werden können – z. B. B2C-Verkäufe, grenzüberschreitenden EU-Handel und Zahlungsdaten aus Kassensystemen.
Irland und Deutschland: Perspektive nach 2027
Irland hat angekündigt, das System ab November 2028 schrittweise einzuführen, beginnend mit großen Unternehmen. Die vollständige Übereinstimmung mit dem EU-Rahmen „VAT in the Digital Age“ (ViDA) soll bis 2030 erreicht werden.
Deutschland hingegen verlangt bereits ab 2025 die Fähigkeit zum Empfang von E-Rechnungen. Ab 2027 wird die Pflicht zur Ausstellung von E-Rechnungen große Unternehmen betreffen, und ab 2028 alle Unternehmen. Kleinstunternehmer (mit einem Jahresumsatz unter 25.000 €) werden von der Ausstellungspflicht befreit, jedoch nicht von der Pflicht zum Empfang.
Herausforderungen und Bedenken der Unternehmen
Obwohl die Digitalisierung der Steuern allgemein als Schritt in die richtige Richtung gilt, äußern viele Unternehmen Bedenken hinsichtlich der Kosten, der Komplexität der Umsetzung und des kurzen Vorbereitungszeitraums.
Besonders betroffen sind kleine Unternehmen, die oft weder über geeignete Software noch über technisches Know-how verfügen. Studien aus Belgien und Irland zeigen, dass die Mehrheit der KMU die Anforderungen der neuen Vorschriften noch nicht vollständig versteht.
In Polen werden Fragen zur Leistungsfähigkeit des KSeF-Systems gestellt, das bis zu 52 Millionen Rechnungen pro Tag verarbeiten soll. In Frankreich führt der Verzicht auf eine kostenlose öffentliche Plattform zu zusätzlichen Kostenfür Unternehmen, die auf private Dienstleister angewiesen sind.
Auf dem Weg in eine digitale Zukunft
Trotz der unterschiedlichen Zeitpläne verfolgen alle diese Initiativen dasselbe Ziel: Bis 2030 soll die gesamte Europäische Union auf E-Rechnungsstellung und digitale MwSt.-Berichterstattung für B2B-Transaktionen umgestellt sein.
Diese Transformation ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einer vollständig digitalisierten Steuerverwaltung in Europa – transparenter, automatisierter und weniger fehleranfällig.